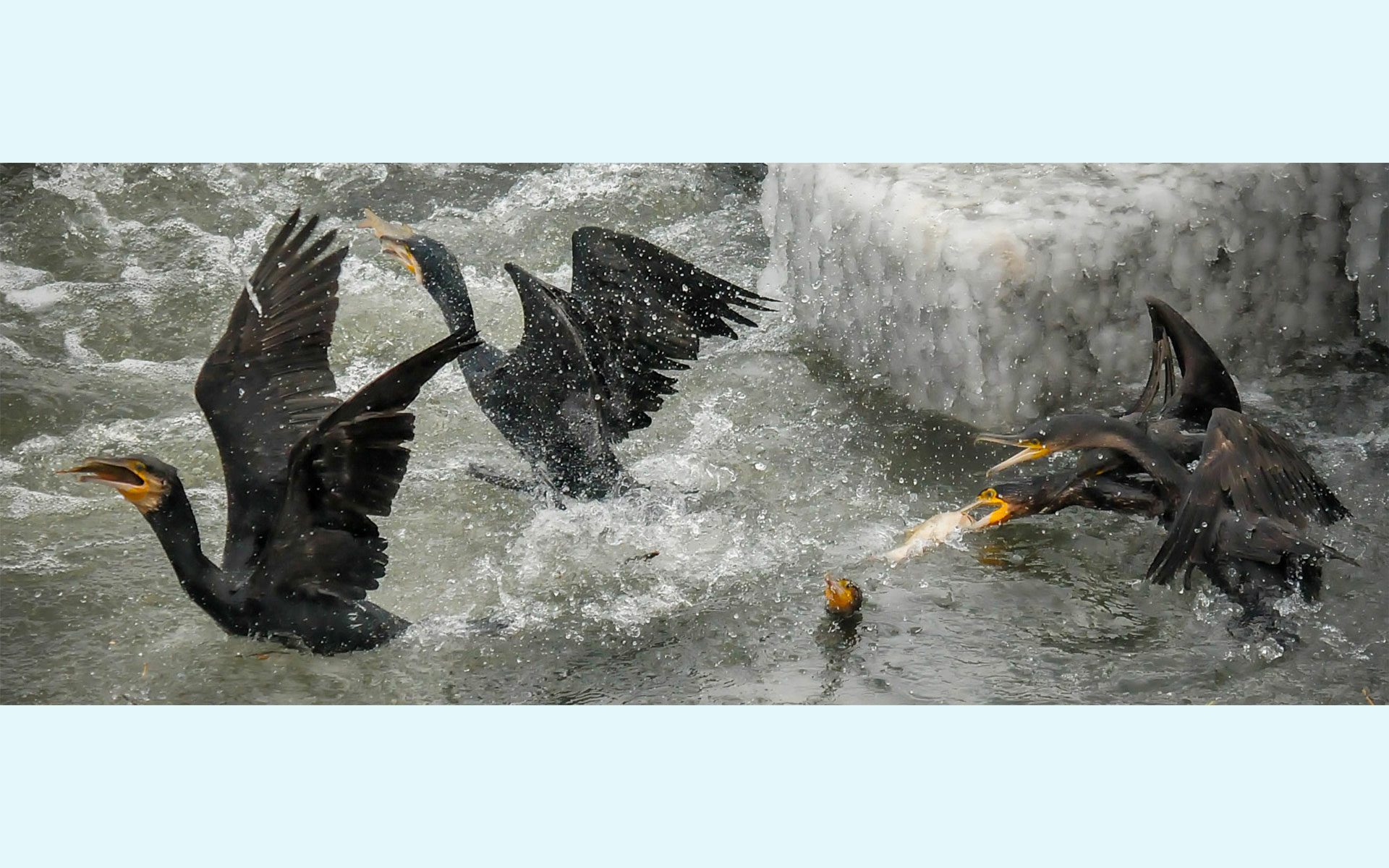Die zweite turnusmäßige Ausbilderweiterbildung des LFVBW unter Leitung des Fachreferenten Karl Geyer fand dieses Jahr am 15.06. in Mühlacker statt.
Mit Freude konnten Dr.Frank Hartmann mit seinem Kollegen Patrick Bartolin vom RP Karlsruhe begrüßt werden. Gleichwohl wurden auch Wolfgang Kämmerle und Igor Kos begrüßt.
Dr.Hartmann stellte erfreut fest, daß der Einladung doch zahlreich Folge geleistet wurde.
Eingangs seines Berichtes nahm er Bezug auf die erst kürzlich aktuelle Hochwassersituation, welche ihm auch die hervorragende Zusammenarbeit mit THW und Vereinen zeigte. Insbesondere die Hege, in diesem Fall konkret die Fischnacheile beim/nach Hochwasser, sind wichtige Bestandteile. Beispielhaft hob er den ASV Linkenheim hervor, der durch Projekte und Artenschutzmaßnahmen engen Kontakt zum RP hält.
Die zunehmende unabwendbare Digitalisierung erfordert die Änderung und Anpassung der Ausbildung der Ausbilder. Wenn Online-(frei von Zeit + Raum) seine Vorteile bieten mag, verbirgt sich dort doch das Problem der Kommunikation. Die Alternative, Präsenzkurs, fordert modern ausgebildetes Personal und Material. Der Praxistag, hat inhaltliche verbindliche Vorgaben, die in der Ausführung anzuwenden sind, Dafür steht die Ausbildungsverordnung.
Fischerei ist Naturschutz! Und Naturschutz findet durch Präsenz am Wasser statt.
Nach einer kurzen Pause stellte sich Wolfgang Kämmerle vor.
-Sternzeichen Fische, ißt Fischstäbchen, sonst keinen Bezug zum Angeln
Als Selbstständiger in der Thematik „Methodik und Didaktik der Ausbildung“ wurde ein sehr anspruchsvolles Themengebiet eröffnet. Sein Leitmotiv die Ausbildung besser und verständlicher gestalten zu können ist in erster Linie die Ausbildung der Ausbilder. Der erfolgreiche Unterricht unterliegt vielen kleinen Einzelfaktoren die so individuell sind wie die Auszubildenden als auch der Ausbilder. In der Kürze der Zeit konnte logischerweise nur an der Oberfläche gekratzt und ein Überblick angezeigt werden.
Nach einer weiteren kurzen Pause ein neues Thema.
Igor Kos, Südbaden, Bezirksreferent für Vorbereitungslehrgänge mit Fischerprüfung
erklärte die Neuerungen und Änderungen zur Fischerprüfung. Es sind einige Änderungen in den Anmeldeformularien und auch in der Abwicklung eines Lehrgangs zu beachten.
Mit Nachdruck wies er auf die Verwendung von vorgeschriebenen Unterrichtsmaterialien hin, die verpflichtend zu verwenden sind.
Er bemängelte die unterschiedlichen Ausführungen des Praxistages und verwies auf die verbindliche Ausbildungsverordnung, als auch auf den Leitfaden für den Praxistag, welcher auch Kontrollen ermöglicht.
Er gab bekannt, dass in Abstimmung mit dem Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz ein neuer Fragekatalog mit neuen Prüfungsfragen ab Juli 2024 in Umlauf kommt.
Die Anwendung der Neuerungen sind ab dem Herbstkurs mit neuem Fragekatalog anzuwenden.
Moderator Karl Geyer, der diesen informativen Tag gestaltete, beendete diese Weiterbildung der Ausbilder mit der Bekanntgabe, daß er in seiner Funktion als Fachreferent für Vorbereitungslehrgänge mit Fischerprüfung nicht länger zur Verfügung stehen wird.