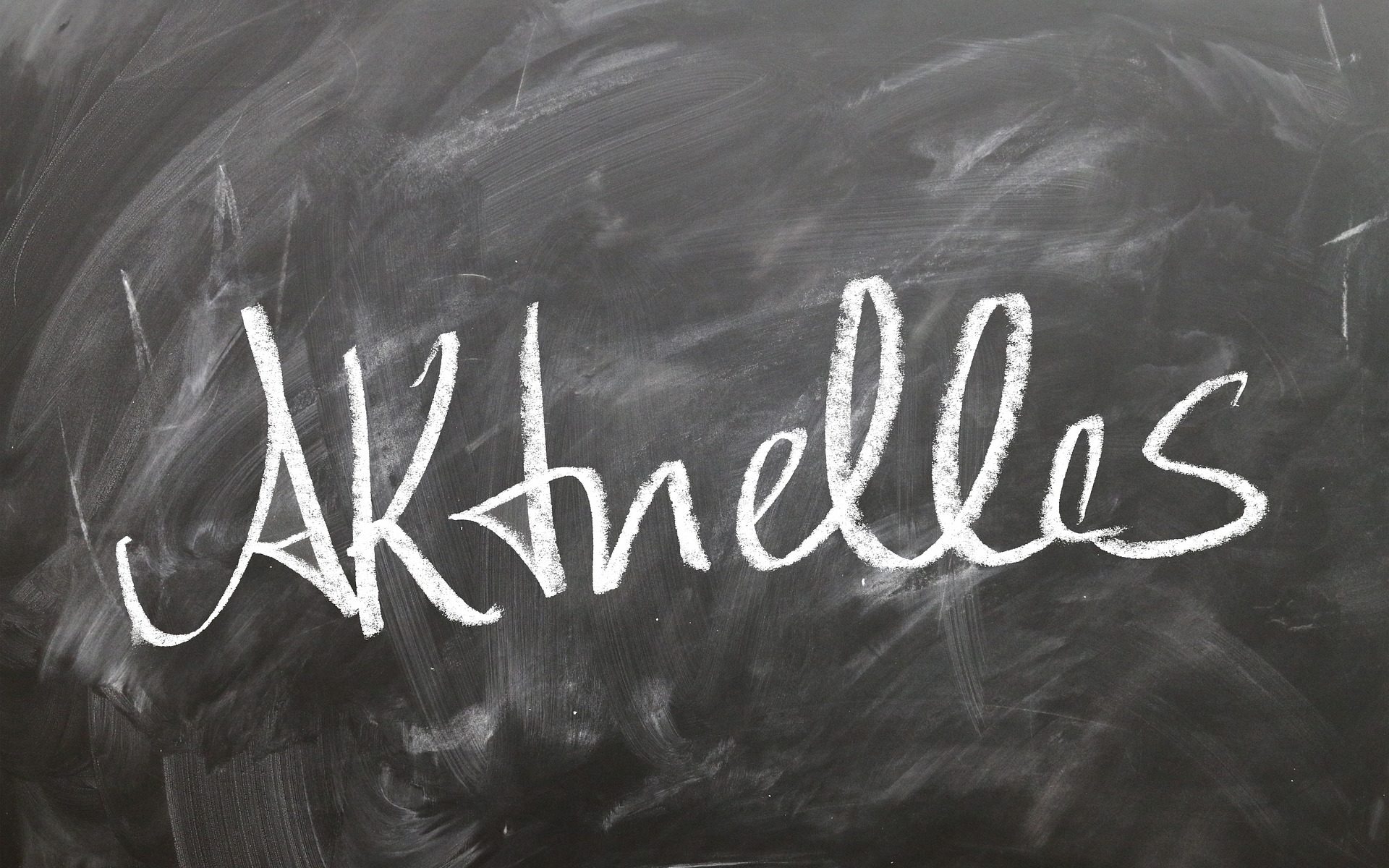Unterhalb der Burg Hohenzollern fand am 25.09.2021 nach einem Jahr Corona bedingter Pause wieder ein Landesfischereitag statt. Trotz der 3-G-Regel erschienen viele Teilnehmer und sie konnten die wohlwollenden Worte der zahlreich geladenen Ehrengäste vernehmen.
Nach den Begrüßungsworten unseres Präsidenten wurden von Herrn Minister Peter Hauk die Leistungen des Verbandes und seiner Mitglieder gelobt und selbst, wenn man sich nicht immer einig war, wie z.B. beim Nachtangelverbot, so sei es doch wichtig, miteinander reden zu können und einen gemeinsamen Nenner zu finden. Um bezüglich des Nachtangelverbotes endgültig beschließen zu können, müsse man leider noch das schriftliche Urteil abwarten, welches jedoch zeitnah erfolgen soll. Hierraufhin bedankte sich Thomas Wahl für die zustimmende Ausführung, mahnte jedoch die Dringlichkeit der Aufhebung an, da es gerade in der kommenden Jahreszeit schnell dunkel wird und somit ein Angler nicht mehr nach Feierabend seinem Hobby nachgehen kann.
Zwischen CDU und den Grünen folgten mit einem herzlichen Willkommen in Hechingen weitere Grußworte von der Ersten Beigeordneten der Stadt Hechingen Frau Müllges.
Herr Reinhold Pix, MdL der Grünen nannte den Verband mit seinen fast 800 Fischereivereinen und mehr als 75.000 Mitgliedern eine wichtige Größe auf der Fläche aber auch unter den Abgeordneten in Stuttgart. Mit anerkennenden Worten charakterisierte er die Fischerei, die durch unseren Einsatz an den Fluss-, Bach- und Seeufern Baden Württembergs zum Schutz und zur Erhaltung des Lebensraumes Wasser, der Artenvielfalt an und im Gewässer und der Pflege von Uferrandgewässern beiträgt. Unsere ausgebildeten Vereins-Gewässerwarte nannte er ein wichtiges Frühwarnsystem für den Zustand unserer Seen und Flüsse. Er dankte für unser Engagement und den unermüdlichen Einsatz sowie für die funktionierende Nachwuchs- und Bildungsarbeit und stellte fest, Verband und Fischereivereine sind wichtige gewässerökologische Wissenszentren.
Politisch korrekt formulierte er bezüglich des Zuwachses der Kormoranpopulationen in BW, dass es als Begleiterscheinungen in stark beflogenen Gewässern zu signifikanten Schädigungen der Fischbestände durch den Kormoran kommen kann. Die zuständigen Ministerien haben sich darauf verständigt, gegebenenfalls mit Ausnahmeregelungen die Vergrämung des Kormorans auch in Schutzgebieten zu ermöglichen. Insbesondere am Bodensee muss dringend gehandelt werden um ein von ihm vehement unterstütztes gemeinsames Kormoran-Management auf dem Weg zu bringen. Dies ist sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben und es werden auch entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Am Bodensee bleibend berichtete er, dass Netzgehege im See keine Alternative zur Erzeugung regionaler Fische darstellen, statt dessen braucht es am See neue Fischzuchten mit modernen Filtersystemen und Durchlauf- oder Kreislaufanlagen.
Zum Thema Jugendfischereischein konstatierte Herr Pix die wichtige Aufgabe, Kinder und Jugendliche für Naturvorgänge zu interessieren und an das Angeln heranzuführen. Bereits heute dürfen unabhängig vom Jugendfischereischein Jugendliche unter 10 Jahren als Helfer einer Fischerei befugten Person fungieren. Vor diesem Hintergrund und dass sich die Kinder und Jugendlichen stolz als Jugendfischerin und Jugendfischer ausweisen können, sieht er eine maßvolle Herabsetzung des Mindestaltes des Jugendfischereischeins für ethisch und pädagogisch unbedenklich.
Abschließend zeigte er Verständnis für den Wunsch und aus seiner Sicht das überraschende Urteil auf Aufhebung des Nachtangelverbotes, jedoch bat er um Berücksichtigung der dringend benötigten Ruhephasen der Lebewesen in den Gewässerrandzonen. Mit der Aufhebung wird es durch notwendige Regelungen in Naturschutzgebieten etc. zu einem Flickenteppich aus Einzelregelungen kommen, was sich als äußerst unbefriedigend, bürokratisch und für die Behörden wohl kaum mehr umsetzbar darstellen wird. Nichtsdestotrotz betont er, dass wir dieselben Ziele verfolgen und verabschiedet sich mit einem herzlichen Petri Heil. Dankend für diese Ausführungen und die Unterstützung widersprach Thomas Wahl mit anwaltlicher Fachkompetenz jedoch, dass dieses Urteil eben nicht überraschend gesprochen worden sei, sondern vielmehr es absehbar war, und entschuldigte sich direkt, da es nicht üblich sei, Grußworten zu widersprechen.
Auch Mitglieder des Landtages von CDU und AfD bekundeten mit kurzen Ansprachen ihre Sympathie zum Verband und unserer Leistung. Ausführlicher sprach der Vorsitzende des Landesnaturschutzverband BW e.V., Herr Dr. Bronner über die aktuellen Probleme auf politischer wie auch auf Natur basierender Ebene. Auch beim LNV BW ist der Kormoran ein immer wiederkehrendes Thema, so soll aufgrund der stetig wachsenden Population nun genetisch überprüft werden, ob es sich inzwischen um eine invasive Variante aus China handelt. Zum Schluss danke er für unsere Unterstützung zur 50 Jahrfeier des LNV BW und betonte die gute Zusammenarbeit unserer Verbände.
Dem schloss sich der Landesjagdverband BW, vertreten durch Hr. Thomas Dietz als letzter Redner an. Ihm war es wichtig zu betonen, dass der LFV BW und der LJV BW Naturschutzverbände sind und Angler und Jäger einen gemeinsamen Nenner haben. Ferner ging er auf die schwierige Vergrämung der Kormorane ein und betonte unser Engagement in der Jugendarbeit.
Mit knapp 45 min. Verspätung konnte nun der erste Vortrag von Justin Guest, Bachelor of Applied Sciences mit dem Thema Hegegemeinschaften… der Weg – die Zukunft begonnen werden. Als federführender Berater für die Aktionen der Hegegemeinschaft ging er auf die Klima bedingten Änderungen allumfassend ein und führte Maßnahmen, Möglichkeiten und Wege auf, diese durch Anpassung der Gewässer und Randzonen möglichst gering zu halten. Einer der wichtigen Vorteile der Hegegemeinschaft ist, gesamte Flussabschnitte gemeinsam mit mehreren Vereinen, Gemeinden und Städten zu „bewirtschaften“. Anfallende Kosten können auf mehrere Träger verteilt werden. Für die Aufmerksamkeit dankend verwies er auf die Basis für diesen Vortrag, dieser kann auf der Homepage: www.hegegemeinschaft-einzugsgebiet –murr.de eingesehen werden.
Weitaus emotionaler wurde der Vortrag von Dr. Werner Baur geführt. Er zeigte auf, dass wir nicht mehr den Klimawandel verhindern können, sondern uns bereits mitten darin befinden. Es sei nicht mehr Fünf vor Zwölf, vielmehr nur noch wenige Sekunden vor Zwölf. Die Erwärmung der Gewässer sei schon weit voran geschritten, Forellen- Äschen- und Barbenregionen verschieben sich temperaturbedingt in höhere Regionen, doch dort stimmen dann die Anforderungen der Gewässerstruktur nicht, eine desaströse Entwicklung. So gut wie kein Gewässer in BW ist noch vollkommen intakt, Makrozoobenthos ist überall nicht mehr in einem guten ökologischen Zustand. Er verweist auf die Vernichtung der Selbstreinigungskraft und der nicht mehr vorhandenen Durchmischung des Wasserkörpers mitsamt den Folgen. Mit Vergleichen von frei zugänglichen Erhebungen im Zeitraffer verdeutlicht Hr. Dr. Baur eindringlich die in den letzten Jahren eingetretene Verschlechterung unserer Gewässer. Die seit Jahren stattfindende Nichteinhaltung verschiedener Richtlinien durch die Regierung tragen ebenfalls zur Verschlechterung bei. Es muss gehandelt werden, es ist nicht mehr Fünf vor Zwölf! Und er möchte seinen Enkeln nicht erklären müssen, dass wir wussten, was auf uns zukommt und wir 30 Jahre nicht gehandelt haben. Mit großem Beifall honorierten die Anwesenden diesen wissenschaftlichen und gleichzeitig emotionalen Vortrag.
Wohlverdient ging es in die Mittagspause. Das Catering entschädigte die entstandene Verzögerung und frisch gestärkt begann der zweite Teil des Landesfischereitages, die Mitgliederversammlung.
Schnell wurden nach Tagesordnung Top 1. Eröffnung und Begrüßung und Top 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähigkeit und der Stimmberechtigung abgehandelt.
Ergänzend zur Tagesordnung wurde nachfolgend eine Todesehrung für inzwischen verstorbene Verbandsmitglieder mit einer Schweigeminute geehrt.
Nach Top 3. Vorstellung des Jahresberichtes des Verbandsvorstandes und der Verbandsausschüsse als Tischvorlage, Top 4. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und 2020 (Corona bedingt) ebenfalls als Tischvorlage und Top 5. Bericht der Kassenprüfer mit Top 6. anschließender Aussprache zu Top 3, 4, 5 konnte unter Top 7. Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsvorstandes abgestimmt werden. 280 Stimmen für die Entlastung mit 1 Gegenstimme sprechen ein eindeutiges Votum.
Nun folgte der große Block Top 8. Wahlen. Neben dem Präsidenten und dem Schatzmeister mussten die Fachreferenten für Angelfischerei, Gewässer, Natur- und Artenschutz, Vorbereitungslehrgänge mit Fischerprüfung, Casting und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kassenprüfer, Beisitzer und Bestätigung des Fachreferenten Jugend gewählt werden.
281 Stimmen sind wahlberechtigt und nach Festlegung der Wahlleitung und der Stimmenauszählung konnte begonnen werden.
Thomas Wahl stellte sich als Präsident wieder zur Verfügung und erhielt 268 Ja-Stimmen, 12 Enthaltungen und 1 Nein-Stimme, er ist somit für weitere 4 Jahre gewählt.
Da sich unser Schatzmeister Hans-Rainer Würfel nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen ließ, wurde mit Gerd Schwarz ein würdiger Nachfolger gefunden und mit 281 Ja-Stimmen, somit einstimmig für das Amt bestätigt.
Der bisherige Fachreferent für Angelfischerei Patrick Schnurr kann wegen der Übernahme eines anderen Amtes nicht mehr antreten, ein Kandidat aus den Reihen der Mitglieder konnte vorerst nicht gefunden werden.
Als neuer Fachreferent für Gewässer wurde Achim Megerle mit 281 Ja-Stimmen, somit einstimmig gewählt.
Der bisherige Fachreferent für Natur- und Artenschutz Thomas Friese wurde mit 280 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme in seinem Amt bestätigt.
Karl Geyer wurde als Fachreferent für Vorbereitungslehrgänge mit Fischerprüfung mit 279 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 1 Nein-Stimme gewählt.
Klaus Boppel wurde als Fachreferent für Casting mit 281 Ja-Stimmen, ebenfalls einstimmig bestätigt.
Wolfgang Groth wurde mit 280 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme für das Amt des Fachreferenten für Öffentlichkeitsarbeit gewählt.
Die Bestätigung des Fachreferenten für Jugend Andreas Kirchner erfolgte mit 281 Ja-Stimmen einstimmig.
Als neue Kassenprüfer wurden Günther Armbruster, Thomas Bernhard und Kurt Mollenkopf einstimmig mit 281 Ja-Stimmen gewählt.
Die neuen und alten Beisitzer Marcus Türk und Christoph Schulz wurden ebenfalls einstimmig mit 281 Ja-Stimmen in ihrem Amt bestätigt.
Unter Top 9. wurde eine Veränderung von § 3 der Beitragsordnung bei Mitgliedschaften in mehreren Fischereiverbänden nach Abstimmung vorgenommen.
Als zweiter großer Tagesordnungspunkt Top 10. wurden die Ehrungen vorgenommen. So wurden geehrt
für besondere Verdienste mit dem silbernen Ehrenzeichen:
Hans Frank, Christoph Schulz, Klaus Boppel, Bettina Narr, Hans-Joachim Hägele, Reiner Harnoß, Jürgen Waldvogel, Gerard Arnold, Marcus Türk, Wolfgang Groth, Thomas Friese und Thomas Lang.
für besondere Verdienste mit dem goldenen Ehrenzeichen:
Thomas Wahl, Jürgen Kath, Andreas Kirchner und Gerd Schwarz.
Zusätzlich erhielten Hans-Rainer Würfel, Roland Sauter und Karl Geyer die silberne Ehrenmedaille.
Hans-Rainer Würfel und Jürgen Kath wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Nach kurzer Kaffeepause ging es mit Top 11. Beschlussfassung über die Feststellung und Genehmigung des Haushaltsplanes 2020 (wegen Corona) und 2021 als Tischvorlage weiter. Erfreulicher Weise konnte für 2021 ein Haushaltsplan mit einem positiven Ergebnis vorgelegt werden. Der Beschluss erfolgte einstimmig.
Da vorliegende Anträge zurückgezogen wurden, konnte direkt zu Top 13. Bestätigung des Landesfischereitages in Stuttgart am 21.05.2022 übergegangen und dieser bestätigt werden.
Top 14. Verschiedenes und Informationen wurde zur Aussprache der beiden Tischvorlagen, die Rechtsstreite zwischen LFVBW und WAV sowie Vorkommnisse im Zusammenhang mit der irregulären Fischerprüfung des ASV Pforzheim genutzt. Der Tenor war eindeutig, WAV und Schock kosten sinnlos Geld, Fischerprüfung abzuhalten trotz klarem Verbot ist indiskutabel.
Mit dankenden Worten beendete Thomas Wahl, alter und neuer Präsident des LFVBW diesen Landesfischereitag.